Vor 55 Jahren übernimmt der T2 das Steuer der Nutzfahrzeug-Erfolgsstory bei Volkswagen. Im August 1972 kommt die zweite Generation des Transporters auf den Markt. Und der neue Bulli ist gekommen, um zu bleiben – 46 Jahre lang.

Der Laderaum hinter den Sitzen misst fünf Kubikmeter.
Er ist der Zweite in der Familie der Volkswagen Transporter und löst 1967 – nach 17 Jahren und rund 1,8 Exemplaren – den Typ 2 Transporter 1 ab. Von Anfang an ein Hannoveraner, rollt der T2 im Nutzfahrzeugwerk vom Band. Mit gewohnt liebenswert runden Kulleraugen blickt die neue Generation Transporter in die Welt. Ein Stück gewachsen und mit erstmals durchgängiger, gewölbter Panorama-Windschutzscheibe verspricht der neue Transporter schon auf den ersten Blick gute Aussichten.

Am laufenden Band.
Er behauptet sich als würdiger Nachfolger des T1. Seine große Variantenvielfalt und robusten Eigenschaften machen den T2 zum Verkaufsschlager. Und er wird zum Bulli, der das Lebensgefühl seiner Zeit verkörpert. Als Symbol für grenzenlose Freiheit auf vier Rädern wird vor allem der Bus schnell zur Flower-Power-Ikone, die das Aufbruchsstreben einer ganzen Generation verkörpert wie Jimmy Hendrix’ Gitarre, Woodstock oder der Marsch auf Washington.

Macht auf den Bulli.
Dass Volkswagen mit dem T2 Großes vorhatte, macht sich bereits an Abmessungen und Ausstattung bemerkbar: Die Fahrerkabine ist komfortabler geworden. Die Karosserie ist bei identischem Radstand von 2,40 Metern und unveränderter Breite auf 4,42 Meter in die Länge gewachsen, die maximale Nutzlast hat sich auf 1.000 kg erhöht. Der Aufbau des T2 besteht nicht mehr nicht aus einer einteiligen Blechhülle mit eigenständigem Bodenrahmen, sondern ist doppelwandig ausgeführt. Das verleiht dem Fahrzeug eine deutlich höhere Steifigkeit. Deutlichen Fortschritt verzeichnet das Fahrwerk, speziell die Doppelgelenk-Schräglenker-Hinterachse sorgt für ein neues, sichereres und komfortableres Fahrgefühl, mit dem diese neue Typ 2 Generation nah an den Pkw-Standard jener Zeit heranrückt. Die seitliche Schiebetür, die beim Schließen den charakteristischen „Bulli-Sound“ fabriziert, ist nun Serie.

Für Spezialisten.
Antriebstechnisch bleibt es beim Käfer-Konstruktionsprinzip, das sich schon beim Vorgängermodell bewährt hatte. Unverändert sitzt im Heck ein luftgekühlter Vierzylinder-Otto-Boxermotor. Dessen Hubraum ist im Vergleich zum Vorgänger durch eine Erhöhung der Zylinderbohrung von 1.493 ccm auf 1.584 ccm vergrößert wurde. Der durch diese Maßnahme um knapp 100 ccm gewachsene Motor leistet dadurch 35 kW (47 PS) – 3 PS mehr als im T1.

Große Vielfalt.
Um die Aufhängung des Boxermotors im Heck zu ermöglichen, wird ein zusätzlicher hinterer Querträger eingebaut. Die zur Kühlung des Aggregats benötigte Luft wird über ausgestellte seitliche Öffnungen am Heck zugeführt. Sie befinden sich in Fensterhöhe an den hinteren Wagenecken und verleihen der Heckpartie ihre charakteristische „Pausbackenform“.

Der Bulli wird 55.
Dienen sollte der T2 wie die Modellbezeichnung „Transporter“ bereits aussagt, zunächst in erster Linie dem Transport von Lasten – vorzugsweise von Material und Arbeitsutensilien von Handwerkern oder Waren wie Elektrogeräten, die es auszuliefern gilt. Zeugen dieser ursprünglichen „Zweckbestimmung“ sind die seinerzeit sehr beliebten Karosserievarianten des Pritschen- und Kastenwagens oder der Kombi als mit Fenstern versehene Variante des Kastenwagens.

Guter Kollege.
Im Laufe seiner Karriere wird dieser Transporter deutlich an Statur gewinnen. Mehr denn je ist er nicht „nur“ Transporter sondern auch Großraumlimousine. Und er präsentiert sich als ideale Basis für Reisemobile. Ein wichtiges Argument für den weiterhin überwältigenden Erfolg des Transporters lieferte die große Angebotsvielfalt: Ausgehend von acht Grundmodellen bietet Volkswagen den T2 schon ab Werk in 17 verschiedenen Ausführungen an.

Reisefreuden mit dem T2b.
Mehr Leistung und Wärme: Mit der Modellpflege kommen ab Mitte 1971 neben leistungsstärkerem Flachmotor mit Doppelvergaser – eine Weiterentwicklung des aus dem Volkswagen 411/412 bekannten Motors mit bis zu 51 kW (70 PS) in der 2,0-Liter-Variante – als Sonderausstattung ein elektrisches Zusatzgebläse für die Heizung und eine verbesserte Warmluftführung im Fahrgastraum hinzu. Sie sorgten dafür, dass es auch auf langen Fahrten in den hohen Norden oder gar dem Trip ins Hippie-Paradies Indien den Insassen stets warm ums Herz blieb.

Campingfreuden.
Mit „Ferien mit dem VW-Campingwagen“, preist der Prospekt im Januar 1968 bereits vier Varianten mit den schlichten Bezeichnungen VW-Campingwagen 60 und 62 an. Der Grundpreis für die Wohneinrichtung liegt bei 1.790 D-Mark.

Der Transporter der zweiten Generation (T2) war in Europa und Amerika auch als Wohnmobil sehr beliebt.
Vor allem die Amerikaner begeistern sich für das kompakte Freizeitfahrzeug made in Germany. Bereits 1968 werden durchschnittlich 100 Campingbusse am Tag gefertigt, ein Viertel der Transporter-Jahresproduktion geht in Frachtschiffen von Emden aus über den Atlantik in die USA. Die Fahrzeuge für den heimischen Markt und Europa werden in Hannover gebaut, in Emden die Wagen für den Export in die USA. Die Produktion läuft auf vollen Touren: 1969 verlässt der 50.000. Campingbus das Band, zwei Jahre später bereits der 100.000. Von 1966 bis 1970 vervierfacht sich der Export der Campingbusse auf knapp 20.000 Exemplare im Jahr, rund 95 Prozent davon sind für Nordamerika bestimmt. Zum Vergleich: Die Inlandszulassungen für Volkswagen Campingbusse überschreiten erstmals 1969 die Marke von 1.000 Exemplaren. 1972 erreicht der USA-Export mit 72.515 Transportern einen historischen Höchststand, etwa ein Drittel davon sind Campingbusse.

Ein Viertel der Transporter-Jahresproduktion schwimmt in riesigen Frachtschiffen von Emden aus über den Atlantik in die USA.
Cooler Bulli: Der T1 und T2 sind inzwischen auch gesellschaftlich zu einem Statement geworden, woran vor allem der nordamerikanische Markt Anteil hatte. Das deutsche Reisemobil mit dem sympathischen Gesicht wird zum Gefährt der amerikanischen Antikriegsbewegung. Als kultureller Re-Transfer erreicht das Flower-Power-Image des Bullis auch Europa, wo ein Bulli seither zum regelrechten Symbol für einen ungezwungenen Lebensstil wurde.

In den 70er-Jahren kombinieren die Amerikaner die eigenhändische Fahrzeugüberführung mit einer Rundreise durch das gute alte Europa.
Aufgrund seiner sprichwörtlichen Unverwüstlichkeit, seiner ausgeprägten „Do-it-yourself-Freundlichkeit“ und der überaus guten Teileversorgung bleibt der Bulli auch nach dem Abklingen der Hippie-Bewegung weltweit das Auto für Individualisten, Camping- und Naturliebhaber aller Art. Als speziell in der Surferszene beliebter Campingbus wird der T2, nicht zuletzt in Form von unzähligen individuellen Umbauten, zum Inbegriff von Sommer, Freiheit und kalifornischem Lebensstil – und letztlich zum automobilen Mythos, der er bis heute ist.

Bist Du auf der Suche nach einem luftgekühlten VW oder Porsche? Oder suchst Du weiter VW-Veranstaltungen? Dann besuche jetzt –::– bUGbUs.nEt –::–
Bildnachweis: Volkswagen AG
Gefällt mir Wird geladen …































 Diese Förderung zahlte sich aus: Anfang der 70er mischten die berühmten Salzburg-Käfer den nationalen wie europäischen Rallyesport gewaltig auf. Am Steuer waren ehrgeizige Profis, die mindestens mit einem Klassensieg nach Hause kommen wollten. Die Fans waren Feuer und Flamme für die in der Regel querstehenden silbernen Hecktriebler mit schwarzen Hauben, den rot-weiß-roten Streifen und der damals so geschätzten Batterie von Zusatzscheinwerfern auf der vorderen Stoßstange.
Diese Förderung zahlte sich aus: Anfang der 70er mischten die berühmten Salzburg-Käfer den nationalen wie europäischen Rallyesport gewaltig auf. Am Steuer waren ehrgeizige Profis, die mindestens mit einem Klassensieg nach Hause kommen wollten. Die Fans waren Feuer und Flamme für die in der Regel querstehenden silbernen Hecktriebler mit schwarzen Hauben, den rot-weiß-roten Streifen und der damals so geschätzten Batterie von Zusatzscheinwerfern auf der vorderen Stoßstange.  Die Motorsportabteilung von Porsche Salzburg residierte in der Salzburger Alpenstraße. Rennleiter war Gerhard Strasser, ein früherer Motorradrennfahrer auf Norton. Herz und Hirn der Tuning-Aktivitäten war Motorenzauberer Paul „Pauli“ Schwarz: Sein Spezialgebiet: Nockenwellen. Zum Team gehörten weiterhin sieben handverlesene Monteure und ein beneidenswerter Lehrling. Das Budget bestand aus Eigenmitteln und Sponsoreneinnahmen. Die Wolfsburger Konzernmutter wirkte nur im Verborgenen, in dem sie z. B. Homologationen wie die der Trockensumpfschmierung ermöglichte. 1972 verfügte die Alpenstraße über elf Käfer 1302 S in Gruppe 2 Spezifikation.
Die Motorsportabteilung von Porsche Salzburg residierte in der Salzburger Alpenstraße. Rennleiter war Gerhard Strasser, ein früherer Motorradrennfahrer auf Norton. Herz und Hirn der Tuning-Aktivitäten war Motorenzauberer Paul „Pauli“ Schwarz: Sein Spezialgebiet: Nockenwellen. Zum Team gehörten weiterhin sieben handverlesene Monteure und ein beneidenswerter Lehrling. Das Budget bestand aus Eigenmitteln und Sponsoreneinnahmen. Die Wolfsburger Konzernmutter wirkte nur im Verborgenen, in dem sie z. B. Homologationen wie die der Trockensumpfschmierung ermöglichte. 1972 verfügte die Alpenstraße über elf Käfer 1302 S in Gruppe 2 Spezifikation.  „Pauli“ Schwarz machte als Achillesferse für den sportlichen Betrieb eines Käfers zunächst die Motorschmierung aus. Bei hohen Kurvengeschwindigkeiten und Lastwechseln schwappte das Öl in der flachen Ölwanne am Saugrohr der Ölpumpe vorbei und der Schmierfilm drohte abzureißen. Nur ein Vergaser, lange, einem Hirschgeweih nicht unähnliche Ansaugrohre sowie kurze Öffnungszeiten der Ventile waren weitere Schwächen. Dadurch wurden die Brennräume nur unzureichend befüllt, der Käfermotor bot nur eine magere Literleistung. Hier setzte „Pauli“ Schwarz an.
„Pauli“ Schwarz machte als Achillesferse für den sportlichen Betrieb eines Käfers zunächst die Motorschmierung aus. Bei hohen Kurvengeschwindigkeiten und Lastwechseln schwappte das Öl in der flachen Ölwanne am Saugrohr der Ölpumpe vorbei und der Schmierfilm drohte abzureißen. Nur ein Vergaser, lange, einem Hirschgeweih nicht unähnliche Ansaugrohre sowie kurze Öffnungszeiten der Ventile waren weitere Schwächen. Dadurch wurden die Brennräume nur unzureichend befüllt, der Käfermotor bot nur eine magere Literleistung. Hier setzte „Pauli“ Schwarz an. 
 Der Aufbau: Der vordere Kofferraum bestand beim Salzburg-Käfer aus einem 80-Liter-Alutank, der den unbändigen Durst des Hecktrieblers stillen musste: bis zu 25 Liter/100 km wurden bei der Rallyehatz gemessen. Eine Domstrebe sorgte für erhöhte Steifigkeit. Die Piloten saßen auf Scheel-Sportsitzen und drehten an einem stark geschüsselten Indianapolis-Lenkrad. Der Motor wurde über einen Aufsatzdrehzahlmesser kontrolliert, dazu gab es drei Anzeigen für das Motoröl: Für Stand, Druck und die Temperatur. Der Öltank der 1303-Versionen wurde im Rücksitzraum platziert, deshalb waren diese als Zweisitzer homologiert. Beim 1302 wurde der Öltank im linken hinteren Radhaus untergebracht, die Homologation erfolgte deshalb als 4-Sitzer.
Der Aufbau: Der vordere Kofferraum bestand beim Salzburg-Käfer aus einem 80-Liter-Alutank, der den unbändigen Durst des Hecktrieblers stillen musste: bis zu 25 Liter/100 km wurden bei der Rallyehatz gemessen. Eine Domstrebe sorgte für erhöhte Steifigkeit. Die Piloten saßen auf Scheel-Sportsitzen und drehten an einem stark geschüsselten Indianapolis-Lenkrad. Der Motor wurde über einen Aufsatzdrehzahlmesser kontrolliert, dazu gab es drei Anzeigen für das Motoröl: Für Stand, Druck und die Temperatur. Der Öltank der 1303-Versionen wurde im Rücksitzraum platziert, deshalb waren diese als Zweisitzer homologiert. Beim 1302 wurde der Öltank im linken hinteren Radhaus untergebracht, die Homologation erfolgte deshalb als 4-Sitzer.  Die Homologation: Die Käfer des Zeitraums 1971 bis 1973 wurden alle nach Gruppe 2-Spezifikation (verbesserte Tourenwagen) aufgebaut. Zum Einsatz kam der Volkswagen 1302 S, im Laufe des Jahres 1973 wurde er vom 1303 S abgelöst.
Die Homologation: Die Käfer des Zeitraums 1971 bis 1973 wurden alle nach Gruppe 2-Spezifikation (verbesserte Tourenwagen) aufgebaut. Zum Einsatz kam der Volkswagen 1302 S, im Laufe des Jahres 1973 wurde er vom 1303 S abgelöst.





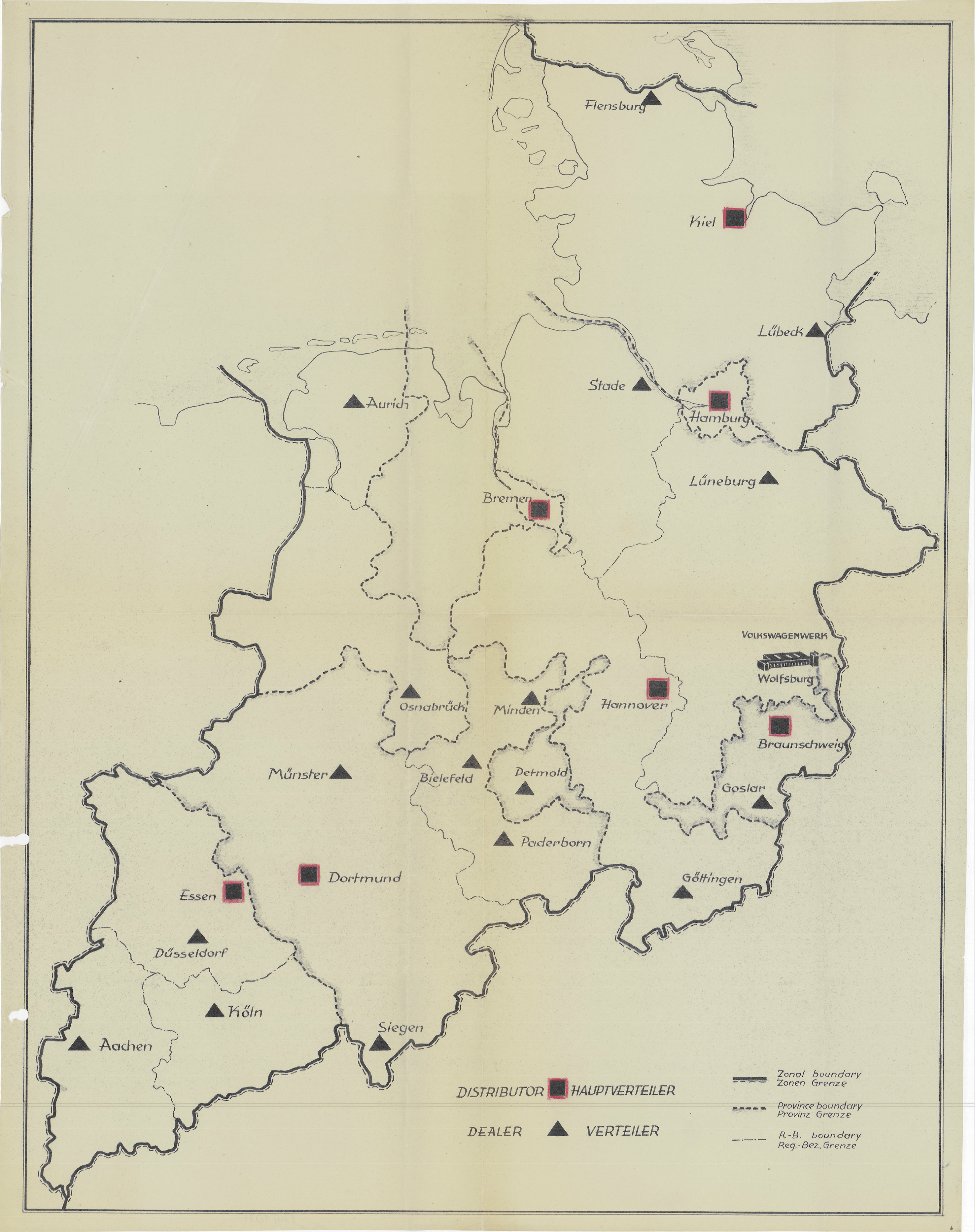


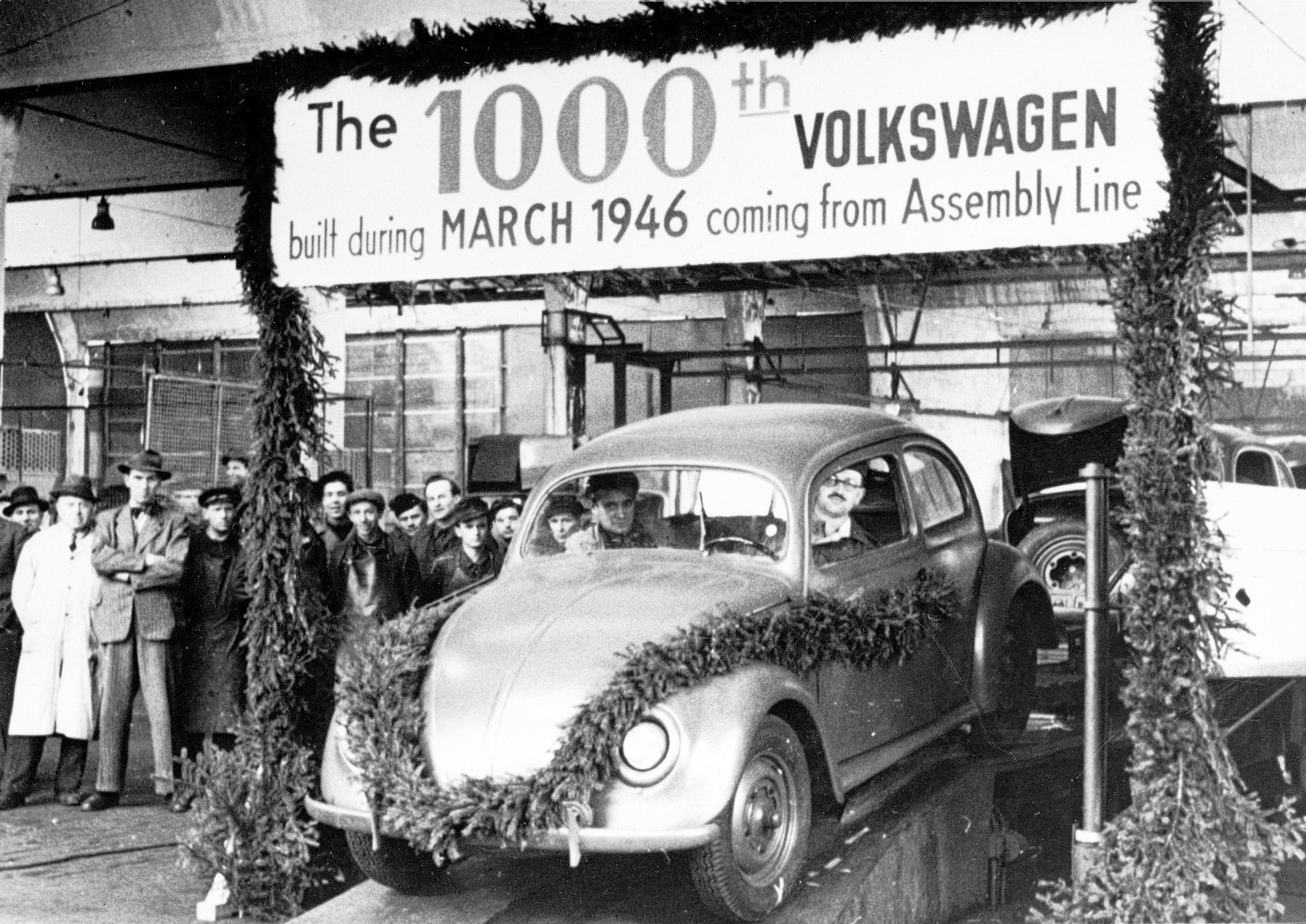









Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.